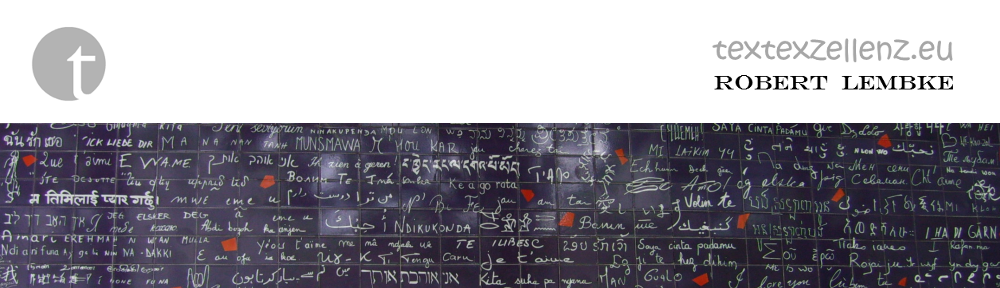Im sechsten Band einer 2012 begonnenen Gesprächsreihe nehmen Alain Badiou und sein Verleger Peter Engelmann unter dem Eindruck aktueller Ereignisse (Kriege, Migrationsbewegungen, Trump) die Diskussion um eine Alternative zum Kapitalismus wieder auf. Der schmale Band besteht aus zwei Gesprächen, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Dezember 2016 in Zürich geführt wurden, und einem kurzen Dialog im Anhang, der auf die Wahl Trumps zum Präsidenten der USA reagiert.
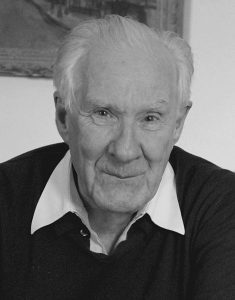
Nur vorwärts, nicht zurück: Alain Badiou gibt die Hoffnung auf eine Überwindung des Kapitalismus nicht auf. | © Keffieh67 / CC BY-SA 3.0
Badious theoretisches Bemühen ist insofern philosophisch zu nennen, als er zunächst einen Punkt zu erreichen sucht, von dem aus sich die bisherige Entwicklung überblicken lässt: „Da heute der Kapitalismus siegreich ist – und das ist eine Tatsache –, muss man zunächst die Idee und das Bewusstsein der Notwendigkeit, dass etwas anderes wirklich möglich ist, wiederherstellen, und zwar von Grund auf.“ (34) Gegenüber Engelmann, der den Begriff Kommunismus als historisch belastet ablehnt, will Badiou an ihm festhalten, um den Bruch zu markieren, der mit einer nichtkapitalistischen Reorganisation der Gesellschaft im globalen Maßstab verbunden wäre.
Auf der Suche nach einer nichtkapitalistischen Modernität
Der Rückblick ins 20. Jahrhundert zeigt jedoch für Badiou, dass etwa im Zeitraum von 1930 bis 1980 die „natürliche Entwicklung [sic!]“ (20) des Kapitalismus geschwächt war bzw. gebremst wurde. Die gescheiterten Experimente des real existierenden Sozialismus seien in ihrer Anlage und ihrem Scheitern noch nicht genügend aufgearbeitet – und sie hätten sich nicht nur ökonomisch nicht gegen den Kapitalismus behaupten können, sondern auch kulturell; geradezu „reaktionär“ (38) seien sie gewesen, während die kapitalistische Moderne sich durch den Widerspruch wachsender persönlicher Freiheit auf der einen und struktureller Ausbeutung auf der anderen Seite behauptet und ausgezeichnet habe.
Man müsse darum „eine Modernität erfinden, die mit etwas anderem kompatibel sein kann als mit dem Kapitalismus“ (37); es bestehe, anders als der „demokratische Diskurs“ suggeriere, den Badiou auch bei Engelmann am Werk sieht, keine Denknotwendigkeit einer Verbindung zivilisatorischer Errungenschaften mit dem Kapitalismus . Wer könnte jedoch die tragende Kraft dieser neuen Politik der Modernität sein? Badiou identifiziert vier Kräfte mit revolutionärem Potential auf globaler Ebene: 1. Das nomadische Proletariat – Heimatlose aller Länder, die auf der Suche nach Arbeit umherziehen, egal ob in Afrika, Europa, oder China; 2. Teile der Mittelklasse (z.B. Arbeiter), die sich wirtschaftlich bedroht fühlen und gegen liberale und populistische Einflüsse immun sind; 3. Teile der Jugend, die für die kommunistische Hypothese empfänglich sind: „Sie sehnt sich im Grunde danach, eine Modernität zu erfinden, die nicht verbrecherisch ist.“ (52); 4. Intellektuelle, die die Bewegung anführen könnten.
Neue Organisationsformen – jenseits von Hierarchie und Autoritarismus
Badiou denkt anschließend vor allem darüber nach, welche Organisationsform eine solche Bewegung annehmen könnte und kommt zu dem Schluss, dass sie – im Gegensatz zu den quasimilitärisch organisierten kommunistischen Parteien alten Stils – eher „biologisch“ und „kapillar“ (56) sein sollte, d.h. aus verteilten Gruppen bestehen, die relativ unabhängig voneinander agieren. Schließlich müsse man sich auch vom hegelianischen Element der produktiven Negativität verabschieden: Der neue Kommunismus werde nicht erst zerstören, um aufzubauen, sondern vor allem schöpferisch sein.
Im zweiten Gespräch wenden sich Engelmann und Badiou der Geopolitik und ökonomischen Globalisierung im engeren Sinne zu. Der französische Philosoph sieht einen Imperialismus des 21. Jahrhunderts am Werk, in dem staatliche und nichtstaatliche Akteure um Einflusssphären und Bodenschätze z.B. in Afrika konkurrieren. Dabei komme es in vielen Regionen der Welt zu einer Destabilisierung von Staaten („Zonierung“, 65), die zwar theoretisch im Sinne des Kommunismus (Absterben des Staates) wäre, einstweilen aber nur Leid und Zerstörung für die dort lebenden Menschen zur Folge hat: „Wenn der Staat nicht vorhanden ist, ist das Volk dem Schlimmsten ausgeliefert.“ (68)
Der sogenannte islamistische Terrorismus, der sich in solchen staatenlosen Räumen festsetzt, ist für Badiou in erheblichem Maße das Produkt westlicher Propaganda – nicht der Islam sei das Problem, sondern dass man es mit einer neofaschistischen Bewegung zu tun habe, die noch dazu als Akteur auf dem Weltmarkt auftritt, und die deshalb zwar antimodernistisch, aber nicht antikapitalistisch sei. Das wiederum verbinde sie mit anderen rechtsgerichteten, d.h. populistischen und nationalistischen Bewegungen: es sei eine Art „immanenter Widerstand“, der jedoch „keinen Gegenentwurf anzubieten habe“ (84). Badiou geht allerdings einen Schritt zu weit, wenn er behauptet: „Der islamistische Terrorismus, Polen, Ungarn, Donald Trump, Le Pen – sie alle gehören zum gleich Lager!“ (ebd.)
Die Ökonomie als Ganzes muss überwunden werden
Wie würde nun die kommunistische Alternative auf globaler Ebene aussehen? Badious Einlassungen hierzu wirken allzu bekannt und eher hohl; von „Gemeinwohl“ ist die Rede und das der Weltmarkt durch eine „Verwaltung auf globaler Ebene“ (90) ersetzt werden müsse – dass das verdächtig nach der gescheiterten Planwirtschaft klingt, bemerkt auch Gesprächspartner Peter Engelmann. Man muss Badiou jedoch zugutehalten, dass er das Problem auf eine sehr abstrakte Ebene hebt: Demnach sei die Überwindung der Ökonomie – die sprachliche Nähe zur „Aufhebung der Ökonomie“ bei Georges Bataille, der freilich anderes im Sinn hatte, ist bemerkenswert – eine Aufgabe, die bisher nicht annähernd gelöst wurde, weil sie gar nicht als Aufgabe begriffen und gestellt wurde. Anders als etwa Marx selbst, der der Überzeugung war, die grundsätzlichen Probleme gelöst zu haben, setzt Badiou also auf eine gewisse theoretische Offenheit bei der Suche nach einer Alternative zum Weltmarkt.
Auf den wiederum berechtigten Einwand Engelmanns, Ansätze zu globaler Solidarität seien kaum zu erkennen, antwortet Badiou mit einer Analyse der politischen Situation insbesondere der Linken, die sich nach der Wahl Trumps weiter verschärft hat. Demnach haben die Kulturalisierung und Intellektualisierung der Linken ihre Entfremdung vom Arbeitermilieu bewirkt – Ähnliches kann man z.B. auch bei Didier Eribon lesen: „Die einzige politische Kraft, die heute im politischen Diskurs das Wort ‚Arbeiter‘ in den Mund nimmt, ist die extreme Rechte. Solche Kategorien sind bei der Linken vollkommen verschwunden.“ (110)
Was also tun? Badious Vorschläge erschöpfen sich leider zu einem großen Teil in vagen Andeutungen, gängigen Sprachspielen und unbestimmten Hoffnungen. Auf der einen Seite beeindruckt das Abstraktionsniveau der Theorie, das es erlaubt, Kapitalismus als endliche und damit überwindbare gesellschaftliche Einrichtung fassbar zu machen; auf der anderen Seite folgt daraus eine gewisse Oberflächlichkeit, die außerdem überall Faschismen am Werk sieht, die es zu bekämpfen und abzuwehren gelte. Dem Widerspruch der Linken, dass sie zum einen als Teil der Establishments gilt, zum anderen sich mit ihren radikalen Forderungen als zu wenig anschlussfähig erweist, kann sich auch Badiou – zumindest im vorliegenden Band – nicht entziehen.
Alain Badiou: Für eine Politik des Gemeinwohls. Im Gespräch mit Peter Engelmann (= Passagen Gespräche 6), Wien: Passagen 2017, 120 S.