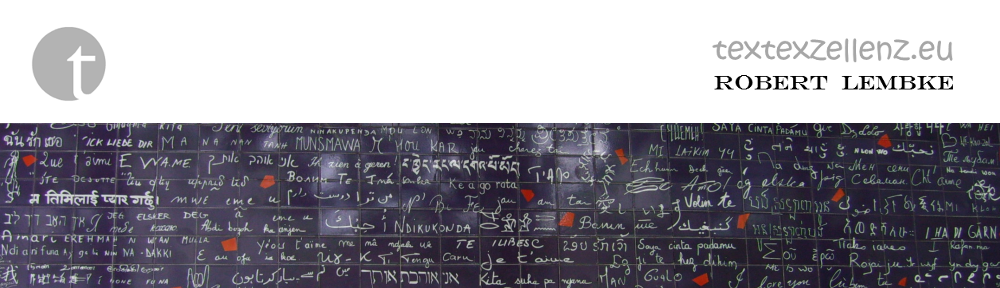Rezension zu: Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit, Wien/Salzburg: Residenz Verlag 2018, 133 S.
Obwohl es Rosa in dem schmalen Bändchen, das auf eine Vorlesung im Literaturhaus Graz im März 2018 zurückgeht, mit Rilke hält, hätte Eichendorffs Wünschelrute mindestens ebenso gut gepasst: „Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.“ Unsere Weltbeziehung zu korrigieren, damit wir jenen ‚Gesang der Dinge‘ wieder häufiger oder überhaupt noch wahrnehmen – nichts weniger hat sich der kritische Sozialphilosoph vorgenommen. Man muss es ihm m.E. hoch anrechnen – denn kaum etwas ist so schwierig wie der Übergang von der Kritik zur Position –, und über weite Strecken gelingt es in vorliegendem Essay sehr gut. Das Zauberwort lautet Resonanz. Es stand im Zentrum seines opus magnum von 2016, wird hier im Zuge einer kultur- und gesellschaftskritischen Generaldiagnose weiter ausgebaut und dabei um wesentliche Dimensionen bereichert.

Einer dieser Aspekte ist die titelgebende Unverfügbarkeit. Für Rosa ist sie irreduzibler Teil der condition humaine, und jeder Versuch, sie aufzuheben oder abzuschaffen, führt in die Irre. In der Moderne insgesamt sieht er jenes zum Scheitern verurteilte Streben am Werk, „das Unverfügbare verfügbar zu machen“ (9). Das Projekt der Moderne, für das Rosa neben einer Fülle an anderen Beispielen den europäischen Kolonialismus als Paradigma anführt, wäre somit – um Habermas zu variieren – nicht nur unabgeschlossen, sondern wesentlich unabschließbar, da bereits im Ansatz verfehlt.
Welche andere Haltung zur Welt ist noch möglich?
Das Verfügbarmachen als verhängnisvolle Kulturtechnik erfolgt in vier Schritten, und unschwer lässt sich darin der Siegeszug der instrumentellen Vernunft wiedererkennen: 1. Sichtbar machen, erkennen; 2. (Räumlich) erreichbar machen; 3. Beherrschen, unter Kontrolle bringen; und 4. (Für sich selbst) nutzbar machen. Die zentralen Begriffe, die dieses Weltverhältnis kennzeichnen, lauten Aggression, (Vergrößerung der) Weltreichweite und, als nur scheinbar paradoxe Folge davon, Weltverlust: Je mehr ich mich der Welt in all ihren Daseins- und Äußerungsformen bemächtigen will, desto mehr entzieht sie sich.
Rosa kann und will hier nicht stehenbleiben, er fragt stattdessen: „Welche andere Welthaltung ist überhaupt denkbar und möglich?“ (34), und hier kommt eben die Resonanz ins Spiel. An vielen lebensnahen Beispiele zeigt der Autor auf, wie man von der Welt bewegt werden kann, ihr antwortet und sich dabei selbst entwickelt, ohne in die Falle des Verfügbarmachenwollens zu geraten. Denn „Resonanz ist konstitutiv unverfügbar“ sowie „konstitutiv ergebnisoffen“ (44). Auslöser für gelingende Welterfahrung kann dabei vieles sein: Musik, Sport, eine Landschaft, die Liebe und anderes mehr. Ja, vielleicht liegt hierin sogar die größte Stärke der Theorie, denn Rosa zeigt, wie sich mit vergleichsweise einfachen, verständlichen Begriffen und Kategorien eine Fülle erhellender und treffender Einsichten sowohl auf lebensweltlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene gewinnen lässt.
Eine weitere treffende Pointe ist die sozusagen resonanztheoretische Reformulierung einer Dialektik der Aufklärung: Dass „die vollends aufgeklärte Erde im Zeichen triumphalen Unheils strahlt“ (Adorno/Horkheimer) ist eine These, von der Rosa am Ende nicht weit entfernt zu sein scheint (worüber er vielleicht selbst erschrocken war und deshalb noch eine abmildernde Schlussbemerkung hinzugefügt hat). Tatsächlich zeigt das 21. Jahrhundert Züge einer monströsen Moderne, die sich begrifflich als Unverfügbarkeit zweiter Ordnung fassen lässt (Kapitel VII sei daher zur Lektüre besonders empfohlen):
„In vielerlei Hinsicht wird die spätmoderne Lebenswelt immer unverfügbarer, undurchschaubarer und unsicherer. Dies führt dazu, dass in vielen Lebensbereichen die lebenspraktische Unverfügbarkeit zurückkehrt, allerdings in verwandelter und beängstigender Form, gleichsam als selbst erschaffenes Monster.“ (124)
Auch das zentrale Motiv der Entmündigung ist hier klar zu erkennen; nur dass diese nicht durch Kulturindustrie, Technik oder Wissenschaft sich vollzieht, sondern gewissermaßen durch das Subjekt selbst: Das falsche Bewusstsein, das uns von der Welt zurückhält, machen bzw. sind wir je selbst. Es sei „sowohl institutionalisiert als auch habitualisiert“ und „durchzieht unsere sozialen Institutionen und Praktiken ebenso, wie [es] unsere innere Haltung prägt.“ (110)
Resonante Weltbeziehung aus dem Geist der Utopie
Dass Rosa trotzdem einen Ausweg sucht, verdient alle Bewunderung; hat seine Diagnose doch große Ähnlichkeit mit der jener, die meinten, dass ‚Praxis verstellt‘ sei oder man nur noch ‚auf Gott warten‘ könne. Natürlich lässt sich gegen einen solchen Versuch – der dem Programm einer „Entzauberung der Welt“ (Weber), das sich in zweiter Potenz als eine fehlgeleitete totale Mobilmachung erweist, konsequent aber romantisch eine Art Wiederverzauberung entgegenstellt – eine Menge einwenden; nur wenige Kritikpunkte seien hier kurz skizziert.
Auffällig ist zunächst der eigentümliche Ton, in dem die gelingende, resonante Weltbeziehung umrissen wird. Er hat etwas Weiches, esoterisch Anmutendes, er scheint etwas beschwören, evozieren zu wollen. Vielleicht ist das angesichts des Gegenstands unvermeidlich, da Rosa sonst selbst in den Widerspruch geriete, Unverfügbares verfügbar machen zu wollen; stattdessen bleibt ihm wohl nichts anderes übrig, als in poetischer oder gar erbaulich anmutender Sprache zu versuchen, „durch den Begriff über den Begriff hinauszugelangen“ (Adorno). Manchmal gelingt dies besser, manchmal weniger gut. Ähnlich wie der Lebenskunstphilosoph Wilhelm Schmid, der seinerzeit mit Foucault begann und heute Interviews u.a. in der Brigitte gibt, scheint Rosa oft nur um Haaresbreite vom Diskurs um Achtsamkeit und ähnlichen Redeweisen entfernt, die möglicherweise selbst ideologischen Charakter tragen, da sie hoffnungslos von den Zurichtungen der kapitalistischen Warenwirtschaft überformt sind.
Daran lässt sich ein zweiter Kritikpunkt anschließen, der darin besteht, dass Rosa seine Überlegungen und besonders die lebenspraktischen Beispiele im pluralis majestatis einer Art bundesdeutschen Angestelltenkollektivs vorträgt. „Wir“ unterliegen diesem und jenem, wenn wir in den Urlaub fahren, wir erfahren Resonanz oder eben nicht, wenn wir lieben, fotografieren oder sportlich aktiv sind. Der Kulturkritiker steht nicht länger außerhalb des Geschehens, sondern nimmt den Standpunkt des „Man“ ausdrücklich ein – der einzige Elitismus, den Rosa sich erlaubt, ist der gefühlt immer etwas zu häufige Verweis auf die eigenen Bücher. Man kann das gut oder schlecht finden; das Fehlen utopischer Exzentrizitäten wie etwa Foucaults „Heterotopien“ verstärkt jedoch eher den klaustrophobischen Druck einer sich dem Menschen entziehenden, nihilistisch zugerichteten Umwelt.
Drittens fällt auf, dass hier nirgends von realen Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnissen die Rede ist. Anders als Rosas ehemalige Kollegen Dörre und Lessenich, die zumindest aussprechen, dass ein Teil der Monstrosität der Moderne darin besteht, reale Gewaltverhältnisse und Ausbeutung zu verschleiern und zu überdecken, ohne sie real aufzuheben, ist bei Rosa ein theoretizistischer Zug zu beobachten: Statt etwa den Widerspruch von Kapital und Arbeit zu thematisieren, konstatiert er als „Grundkonflikt der Moderne“ die „kategoriale Verwechslung von Erreichbarkeit und Verfügbarkeit“ (66). Das klingt dann doch seltsam weltfremd und abgehoben.