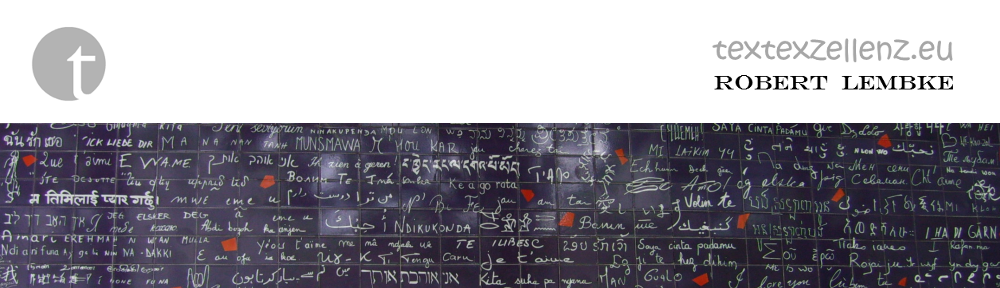Trump ist im Amt – noch immer. Seit nunmehr über einem Jahr dilettiert der Mann an der Spitze des mächtigsten Landes der Welt munter vor sich hin. Erreicht hat er freilich nicht viel, auch weil sich mutige Männer und Frauen ihm immer wieder entgegengestellt haben. Selbst die Macht der Medien, die jeden Fauxpas genüsslich kommentieren und skandalisieren, ist offenbar nicht groß genug, um den Usurpator aus der Wirtschaft zu Fall zu bringen. Und so gehen sie weiter, die Fehltritte und Beleidigungen, begleitet von Wellen der Entsolidarisierung auf landes- und geopolitischer Ebene.

Reißt weiter das Maul und gesellschaftliche Gräben auf: Wie lange noch, Trumpo? | © Gage Skidmore [CC BY-SA 3.0]
Ohne Lösung der Eigentumsfrage kein Ende des Kapitalismus
Der ganze politisch-mediale Komplex mit seinen »sehr feinen Unterschieden«, die aber im Großen und Ganzen nichts zum Positiven verändern, »desorientiert« im Wesentlichen die Menschen. Eine Folge davon sei das Aufkommen eines »demokratischen Faschismus«, deren extremstes Beispiel eben dieser Trump sei – mitnichten jedoch etwas Neues, sondern eine »externe Interiorität«, die neben Sekundäruntugenden wie Nationalismus, Sexismus und Rassismus vor allem die »Propaganda des Privateigentums« weitertreibe. (16-19)
Zurecht erinnert Badiou an die Eigentumsfrage, die »das Herzstück des Marxismus« (14) bilde, der einmal, nach einem Wort von Sartre, »der unüberschreitbare Horizont unserer Kultur« gewesen sei. Die fortschreitende Kapitalkonzentration in den Händen weniger zeige die ungebrochene Richtigkeit dieser Theorie und müsse zum Anlass einer Wiederbelebung von Dialektik und Politik werden. Badiou sieht die Wirklichkeit von vier großen Tatsachen bestimmt: dem Sieg des globalen Kapitalismus, dem Zerfall der traditionellen bürgerlichen Oligarchie, der Verunsicherung und Frustration vieler Menschen und dem Fehlen einer Idee, die revolutionäre Potentiale binden könnte.
Der wahre Widerspruch der zurückliegenden US-Wahl sei nicht der zwischen Trump und Clinton gewesen, die beide Mitglied der globalen kapitalistischen Oligarchie seien, sondern zwischen Trump und Bernie Sanders, der zumindest in Ansätzen etwas formuliert habe, was sich jenseits des global-kapitalistischen Konsenses stellt – für Badiou freilich höchstens ein Anfang und nicht radikal genug.
Die neue Vierteilung des politischen Spektrums
Zwei Wochen nach der Wahl – Badiou ist mittlerweile in Boston an der Tufts University – hat sich der Ton gewandelt. Es geht nun ausdrücklich um »philosophische« Überlegungen; Trump sei zwar »eine interessante Tatsache«, man dürfe ihn aber keinesfalls überbewerten, denn er sei hauptsächlich ein Symptom, »etwas Undurchsichtiges und nicht wirklich Interessantes« (29). Viele Punkte aus der ersten Vorlesung werden wiederholt; neu ist vor allem eine Analyse des politischen Spektrums der demokratischen Staaten, das sich von einer Zwei- zu einer Vierteilung bewege: Trumps Sieg sei vor allem deshalb möglich gewesen, weil er sich weiter außen, d.h. auf der Grenze von Demokratismus und Extremismus bewege. Schaut man sich Frankreich (Melenchon, die Sozialisten, Macron, Le Pen) und Deutschland (LINKE, SPD/Grüne, CDU/CSU, AfD) an, scheint diese Analyse zutreffend; leider spricht Badiou an dieser Stelle nicht systematisch über die Parteien bzw. die politische Situation einzelner Länder.
Als Philosoph kommt es ihm vor allem darauf an, eine wirkliche Alternative zu formulieren, eine Idee, die sich in einer Bewegung materialisieren könnte. In Anlehnung an das berühmte Diktum von Marx, dass die Idee zur materiellen Gewalt werde, wenn sie die Massen ergreift, formuliert Badiou: »Eine Idee ist die Möglichkeit einer Bewegung, die sehr verschiedene Subjekte vereint.« (48) Wie aber lauten ihre Bestimmungen? Es sind die Inhalte des – von heute aus gesehen – utopischen Kommunismus, die unerreicht am Horizont aufleuchten: Eindämmung des Privateigentums; Überwindung des Gegensatzes von geistiger und körperlicher Arbeit; Gleichheit als Dialektik der Differenz, Unterschiede als Ausdruck von Gemeinsamkeit und die Infragestellung des Staats als Machtapparat zugunsten freier Assoziationen.
»Etwas erschaffen, das jenseits des Systems liegt«
Entsprechend lang ist der Weg, um von hier nach dort zu kommen. »Aus dem bestehenden System heraus kann keine Perspektive für etwas Neues entwickelt werden. Deswegen müssen wir etwas erschaffen, das jenseits des Systems liegt.« (53) Hier ist man versucht, systemtheoretisch informiert gegenzufragen: Wie anschlussfähig ist das Ganze? Zumindest eine Ahnung davon vermitteln die vier den schmalen Band abschließenden Fragen aus dem Publikum, eine m.E. gelungene verlegerische Entscheidung: Wie reagiert der gebildete, eher linke Amerikaner, der an diesem Tag in die Tufts University gekommen ist, auf Badious Vortrag? (Das hohe Bildungs- und Reflexionsniveau der Fragen legt allerdings nahe, dass es sich möglicherweise um Professoren handelt.)
Gleich die erste Frage nach der konkreten politischen Organisation der kommenden Bewegung lockt Badiou aus der Reserve: In einem langen Exkurs zu Lenin und zur Geschichte der kommunistischen Parteien macht er die Schwierigkeiten deutlich, Staatsorganisation und die Ideen der Bewegung zur Deckung zu bringen; allen Ernstes empfiehlt er »eine Diktatur des Volkes über den Staat« (59) – wo kommt plötzlich die Kategorie des Volkes her? –, die eben die ursprünglichen Ziele der Bewegung nicht verraten dürfe, wie es in der Sowjetunion, in China und anderswo geschehen sei. Mach’s noch einmal, Alain, nach Millionen und Abermillionen von Menschenopfern?
Von den insgesamt vier Fragen liefert vor allem die dritte weitere Aufschlüsse: Gegenüber dem Einwand, Trump sei vor allem ein Gegner des Freihandels und Vertreter eines neuen »ökomischen Nationalismus«, betont Badiou m.E. zurecht, dass das Hauptproblem doch sei, dass die Politik die Kontrolle über die globalen Geldströme verloren habe und daran auch Trump, diese »widersprüchliche« Figur, nichts ändern werde. Anschließend erlaubt sich Badiou die etwas chiliastisch anmutende Zuspitzung, dass nach der vollständigen Expansion des Kapitalismus nur noch zwei Möglichkeiten bestünden: der Übergang zum Kommunismus oder ein Rückfall in die Barbarei, letztere in Form von »Atomkrieg« (66), zum Beispiel im imperialistischen Kampf um den Einfluss in Afrika.
Fazit: Ein gerade mit etwas zeitlichem Abstand lesenswerter Band, der anschaulich macht, welche Zeitenwende der Polit-GAU namens Trump bedeutet und welche dahinterliegenden Problem- und Motivationslagen politisch-philosophisch in Betracht gezogen werden müssen. Befremdlich wirkt Badious offenbare oder uneingestandene Nähe zum Leninismus, der man höchstens zugutehalten kann, aus welcher unendlich unterlegenen Position er mit seiner Theorie zu operieren versucht. Der unnachgiebige Impuls, sich mit dem überall lauernden Konsens des falschen Lebens nicht gemein zu machen und der übermächtigen Realität zum Trotz auf einen utopischen Kommunismus zu setzen und zu hoffen, darf dagegen durchaus Bewunderung hervorrufen.
Alain Badiou: Trump. Amerikas Wahl, Wien: Passagen-Verlag 2017, 72 S.