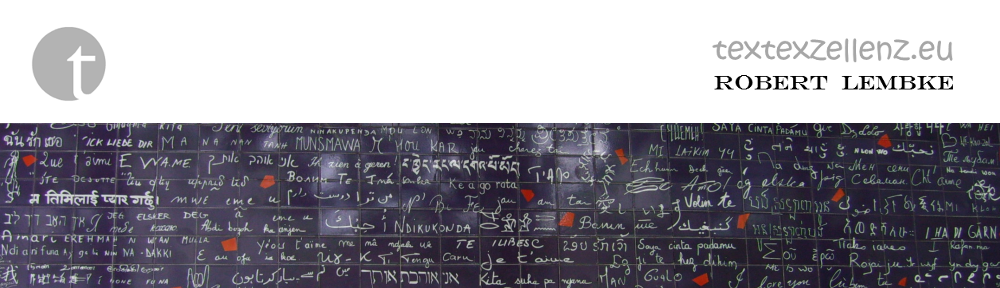Solidarität ist in aller Munde und ist doch unendlich fern. Erst hieß es: „Wir schaffen das!“, und eine bewundernswerte „Willkommenskultur“ durfte sich kurz zeigen; dann kamen alsbald das völkische Ressentiment und die neurechte AfD. Wer heute nach Solidarität fragt – verstanden als ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das über die unmittelbaren vitalen Interessen des Einzelmenschen hinausgeht –, sieht sich einem immensen Block aus Selbstbehauptung, Partikularismen und gesellschaftlicher Desintegration gegenüber, der theoretisch wie praktisch undurchdringlich scheint.
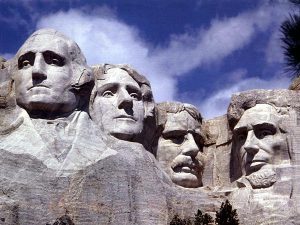
Rortys kulturalistisches Verständnis von Solidarität würdigt vor allem die Leistung der amerikanischen Gründerväter.
Diesem Befund entspricht die Perspektivlosigkeit weiter Teile der Linken, die sich offenbar in einer strukturellen Sackgasse befindet. Dem inflationären und ideologischen Gebrauch des Wortes „Solidarität“ hat sie wenig entgegenzusetzen, weil die moralischen Quellen versiegt sind, aus denen sie sich speisen könnte. Will man jedoch Solidarität als gemeinsamen Bezugspunkt linker Auffassungen zurückgewinnen, wird man sich um ein Verständnis ihres Begriffs bemühen müssen, das jenseits von Umverteilungsdebatten oder globalen Finanzströmen liegt.
Wie lassen sich Selbsterschaffung und Sozialdemokratie zusammendenken?
Ein Denker, der der Solidarität einen zentralen Platz einräumte, war Richard Rorty. Mit seltener Klarheit und Entschiedenheit überwand er die sprachanalytische Enge der amerikanischen Philosophie in der Folge Wittgensteins – nicht ohne ihr jedoch eine besondere, mit der Kontinentalphilosophie kompatible Gestalt zu schenken: den Versuch nämlich, Selbsterschaffung und Sozialdemokratie zusammenzudenken, d. h. das Streben der Individuen nach Autonomie mit einer möglichst umfassenden Solidargemeinschaft von Menschen zu versöhnen.
Artikel als PDF (erschienen in Widerspruch. Münchner Zeitschrift für Philosophie 62, 2016)